Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenDer Fesselträgerschaden ist für viele Pferdemenschen ein Horrorszenario. Doch was bedeutet ein Fesselträgerschaden beim Pferd genau, wie ist die Anatomie des Fesselträgers beim Pferd und ist die Prognose eines Fesselträgerschadens wirklich “unreitbar”? Diese Fragen wollen wir im folgenden Text einmal genauer beleuchten.
Die Anatomie des Fesselträgers
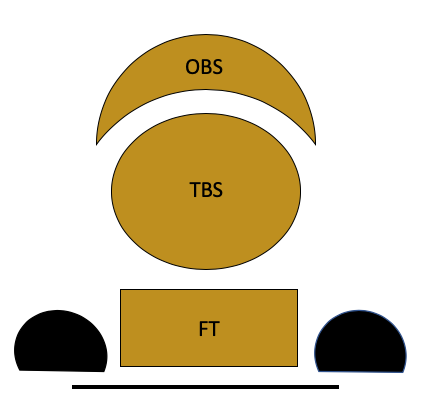
Der Fesselträger ist ein rudimentärer Muskel mit bandhaften Charakter, dessen Entzündung eher als Sehnenentzündung angesehen wird. Seine Lage ist an den Vorderbeinen auf der Rückseite des Röhrenknochens zwischen dem Vorderfußwurzelgelenk und dem Fesselgelenk. Und hinten liegt er zwischen dem Sprunggelenk und dem Fesselgelenk. Daneben ist er links und recht begrenzt von den Griffelbeinen. Deswegen heißt er im Übrigen auch lateinisch interosseus, denn das heißt übersetzt zwischen den Knochen. Über ihm liegt dann noch die Tiefebeuge- und Oberflächlichebeugesehne.
Der Fesselträger beim Pferd ist also ziemlich eingekesselt, was leider zur Folge hat, dass Schwellungen nicht immer von außen sofort sichtbar sind. So werden Schäden oft erst erkannt, wenn sie schon sehr massiv sind, ein großer Strukturdefekt und/oder Lahmheit vorliegt.
Ziel sollte es daher sein, dass du den Fesselträger im Rahmen deiner Putzroutine selbstständig kontrollieren und so frühzeitig reagieren kannst. Und das geht ganz einfach und schnell 🙂
Hier erfährst du wie:
Anatomischen Bestandteile eines Fesselträgers
Des Öfteren wird auch vom Fesselträgerapparat gesprochen, da er sich genauer ausgedrückt aus Ursprung, Körper und Unterstützungsschenkel zusammensetzt.
Fesselträgerursprung: Startpunkt ist eine Verbindung zum Knochen, und zwar an der untersten Reihe des Vorderfußwurzelknochens und dem oberen Ende des Röhrbeins.
Fesselträgerkörper: Der Hauptteil verläuft entlang des Knochens nach unten, dort setzen einige Fasern an der Faszie im Bereich der Fessel an.
Fesselträgerschenkel: Der Großteil des Fesselträgers aber teilt sich im unteren Bereich knapp über dem Fesselgelenk in zwei Stränge, die dann an die jeweiligen Außenseiten der Gleichbeine reichen und von dort zwei Unterstützungsschenkel zur gemeinsamen Strecksehne abgeben.
Der Fesselträger und seine Funktion
Seine Funktion ist es, wie der Name schon sagt, das zu tiefe Durchfesseln zu verhindern. Er trägt die Fessel und fängt das Eigen- und Zusatzgewicht ab. Aus diesem Grund wird der Fesselträger besonders belastet in allen Situation in denen er das Durchfesseln verhindert, sprich Piaffe, Passage, das Landen nach einem Sprung oder auf weichen Boden. Die Aufgabe des Fesselträgers ist also statischer Natur; er hält die Fessel und bewegt sie nicht. Dazu verbindet er noch Knochen mit Knochen und daher ist seine Aufgabe auch eher die eines Bandes als einer Sehne.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Fesselträger durchaus einer vermehrten Belastung, wie es bei den oben genannten Aktivitäten der Fall ist, standhalten kann. Voraussetzung dafür ist aber — und der Punkt ist wirklich sehr wichtig — die Pferde erfahren ein gutes Gesundheits- und Trainingsmanagement und das Gewebe wird so auf die Belastung vorbereitet!
Der Fesselträgerschaden beim Pferd: Die Diagnose
Wie bereits oben angesprochen, besteht der Fesselträger aus mehreren anatomischen Strukturen und je nach Lokalisationen braucht es unterschiedliche Mittel zur Diagnose.
Erkrankungen im Ursprung: Sind begleitet mit Veränderungen des Knochens aufgrund der Knochenbefestigung. Daher kommt zur Diagnosefindung das Röntgen zum Einsatz. Hier sieht man Sklerosierung oder sogar Ausrissfrakturen. Mit Hilfe der Szintigraphie und dem MRT lassen sich Knochenveränderungen zeigen, die auf dem Röntgen noch nicht zu sehen sind.

Erkrankung des Körpers: In der Regel wird der Ultraschall genutzt. Jedoch ist dies schwierig, da der Fesselträger aufgrund seiner Eigenschaften als rudimentärer Muskel ein entsprechendes Durcheinander an Fasern aufweist. Auf dem Ultraschall sieht man keine linear ausgerichteten Fasern, sondern auch im gesunden Zustand durch die Muskelfasern leichte Wellen, Unregelmäßigkeiten und Auflockerungen. Daher wird hier bei weniger massiven Schäden im Ultraschall der Seitenvergleich herangezogen oder das MRT kommt zum Einsatz.
Erkrankungen des Fesselträgerschenkels: Hier sind Schäden am besten durch das Ultraschallgerät zu finden. Der Ansatz der Schenkel an dem jeweiligen Gleichbein verhält sich ähnlich wie der Ansatz der TBS am Hufbein als Teil der Hufrolle. Es kann die Sehne, der Knochen oder beides betroffen sein und so entweder der Ultraschall, das Röntgen oder beides Sinn machen.
Möchtest du noch mehr Details über die Diagnostik erfahren? Dann schau hier in mein Video zum Thema Schäden an Sehnen und Fesselträger unter der Lupe.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenFesselträgerschaden beim Pferd: Die Therapie
Je nach dem, wo der Schaden im Fesselträger ist, unterscheiden sich die Therapie, Prognose und Rehabilitation. Ist der Knochen in Mitleidenschaft gezogen, wie es bei einem Schaden am Ursprung der Fall sein kann, kann die Therapie zum Beispiel mit Stoßwellen oder Medikamenten für den Knochenstoffwechsel ergänzt werden. Bei Defekten im Körper kann Ruhe und Reha ausreichen. Bei großen Strukturdefekten machen regenerative Therapieformen Sinn. Auch chirurgische Maßnahmen sind möglich.
Doch merke dir:
Die Rehabilitation hat einen größeren Einfluss auf die Heilung als die Art der Therapie! Ich wiederholen das gerne, damit das im Gedächtnis bleibt!
Fesselträgerschaden beim Pferd: Die Prognose

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenFesselträgerschaden beim Pferd: Das Antrainieren
Direkt nach dem Insult wird 7 Tage Boxruhe empfohlen mit drei Tagen kühlen sowie über die erste Woche Entzündungshemmer. Im Anschluss sollte kontrollierte Bewegung im Schritt erfolgen, sodass die Ausrichtung der Sehnenfasern erfolgen kann. Zeitangaben sind hier schwer zu nennen, da jeder Schaden in Ausmaß und Lokalisation unterschiedlich ist. Bitte beachte dies.
Im Handbuch für Pferdekrankheiten stehen zum Beispiel für den FT-Körper 3 Monate kontrollierte Schrittbewegung als Ratschlag, gefolgt von 3 Monaten Bewegungsprogramm, bis nach 6 Monaten die sportliche Belastung wieder aufgenommen werden kann. Beachte, dass aufgenommen nicht gleichbedeutend ist mit ursprünglichem Leistungsstand wiederhergestellt.
Springen nach Fesselträgerschaden
Wann nach einem Fesselträgerschaden wieder gesprungen werden kann und ob, ist eine sehr individuelle Frage. Deswegen auch hier der Hinweis, dass dies mit dem behandelnden Tierarzt abgesprochen werden muss. Auf Basis der Daten aus dem Lehrwerk wäre aber die grobe Rechnung bis zum ersten Springen:
3 Monate Schritt + 3 Monate kontrollierte Bewegung und 3 weitere Monate bis zum Aufbautraining plus mindestens nochmal 3 Monate nach dem Aufbautraining ein spezielles Ausdauer- und Krafttraining. Meine Empfehlung ist daher: Kein Springen für 1 Jahr, dann langsam anfangen.
Ganz detailliert erfährst du alles über Aufbau- und Grundlagentraining in meinem Trainingskurs.
Ein korrekter Trainingsplan ist besonders für Pferde nach einem Fesselträgerschaden wichtig, um eine gute Prognose und ein fittes Pferd für die Zukunft zu erhalten. Denn damit nach dem Schaden nicht vor dem nächsten Schaden ist, solltest du unbedingt das Management des Pferdes reflektieren: Haltung, Fütterung, Training, Equipment, Hufbearbeitung usw. Denn hier nochmal zur Erinnerung: Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Fesselträger von einmal über die Wiese bocken oder einem Parcours auf schlechten Bodenverhältnissen kaputt geht, ist deutlich geringer als durch eine ungesunde Lebensführung.
Wir beantworten Fragen wie…
- Überfordere ich mein Pferd?
- An welchen Tage soll ich was und wie viel machen?
- Wie kann ich ohne viel Equipment sinnvoll trainieren?
- Mein Pferd hatte krankheitsbedingt eine Pause, wie gestalte ich das Aufbautraining?
- … und noch vieles mehr!
Lass dich gleich unverbindlich für den nächsten Kursstart vormerken. Dadurch erhältst du eine Erinnerung und einen Gutscheincode wenn die nächste Runde startet. Der Kurs Trainingsplanung aus medizinischer Sicht startet
in die nächste Live Runde.
Vom wagen Bauchgefühl zu messbaren und sichtbaren Fortschritten:
Gestalte auf medizinischer Grundlage eigenständig deinen Trainingsplan und erreiche ein fittes und starkes Pferd.
Wann nach einem Fesselträgerschaden wieder gesprungen werden kann und ob, ist eine sehr individuelle Frage. Auf Basis der Daten aus dem Lehrwerk wäre aber die grobe Rechnung bis zum ersten Springen:
3 Monate Schritt + 3 Monate kontrollierte Bewegung und 3 weitere Monate bis zum Aufbautraining plus mindestens nochmal 3 Monate nach dem Aufbautraining ein spezielles Ausdauer- und Krafttraining. Meine Empfehlung ist daher: Kein Springen für 1 Jahr, dann langsam anfangen.
Wie bereits oben angesprochen, besteht der Fesselträger aus mehreren anatomischen Strukturen und je nach Lokalisationen braucht es unterschiedliche Mittel zur Diagnose. Ultraschall ist daher zum Beispiel bei Erkrankungen des Körpers und des Schenkels gebräuchlich. Während beim Ursprung das Röntgen aufgrund der Knochenbeteiligung zum Einsatz kommt.
Des Öfteren wird auch vom Fesselträgerapparat gesprochen, da er sich genauer ausgedrückt aus Ursprung, Körper und Unterstützungsschenkel zusammensetzt.
Der Fesselträger beim Pferd ist also ziemlich eingekesselt, was leider zur Folge hat, dass Schwellungen nicht immer von außen sofort sichtbar sind. So werden Schäden oft erst erkannt, wenn sie schon sehr massiv sind, ein großer Strukturdefekt und/oder eine Lahmheit vorliegt.


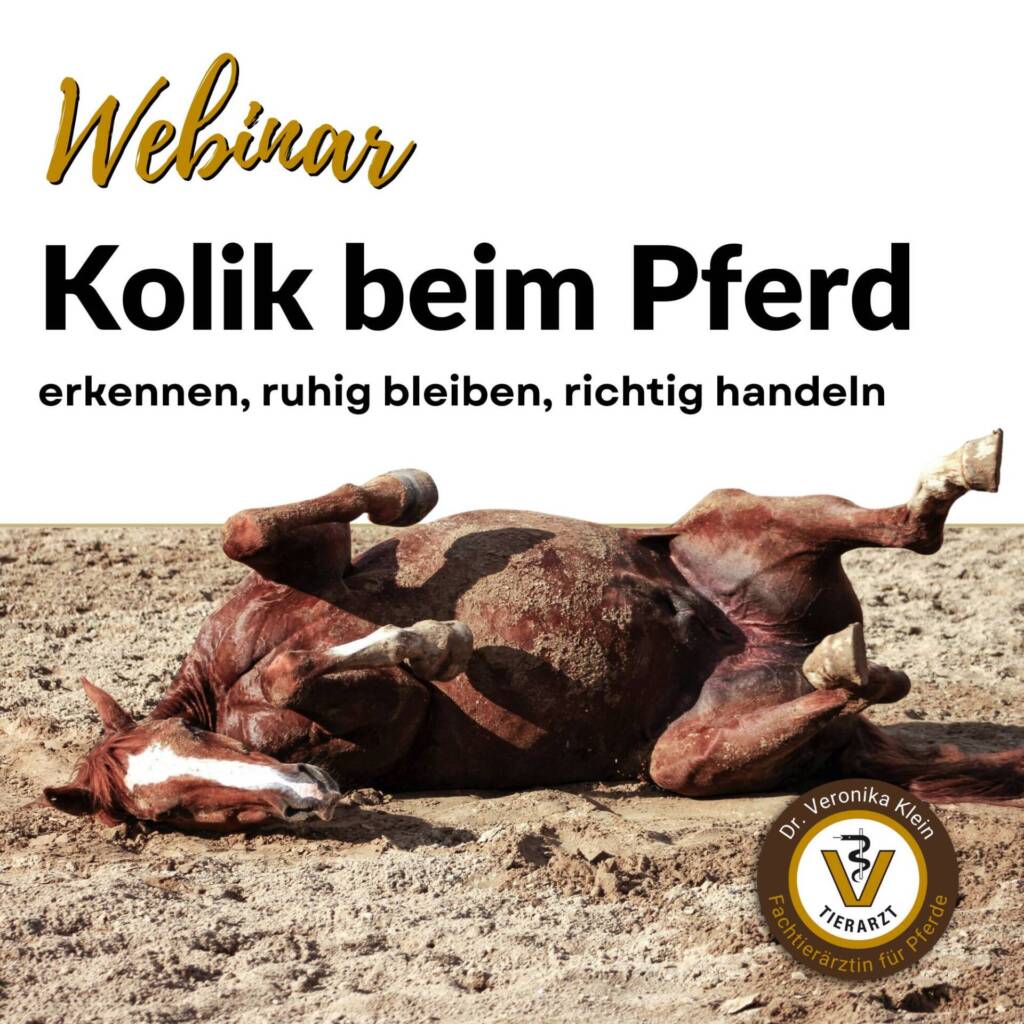
[…] https://kernkompetenz-pferd.de/der-fesseltraegerschaden-beim-pferd/ […]